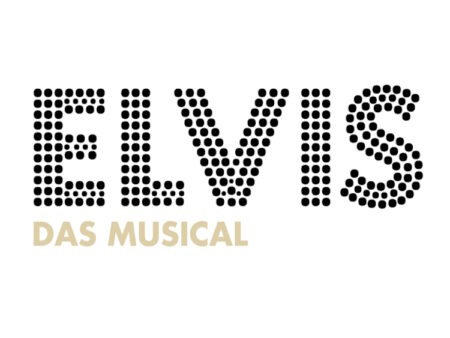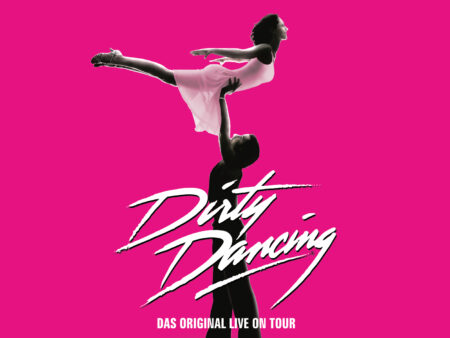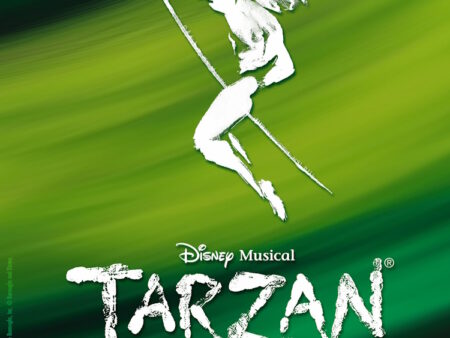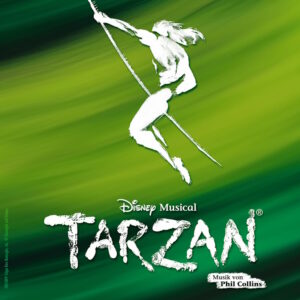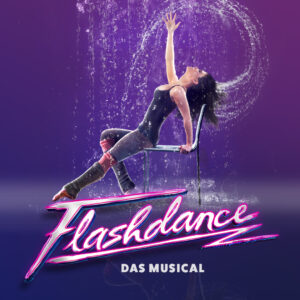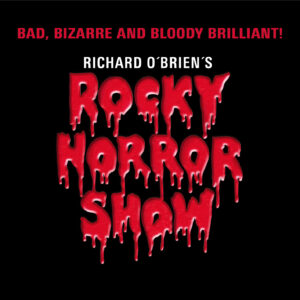De Schmiede sein vu Stoahl und Eisen, aber an Schneider mag se nich.
De schmött wît ( schmeisst weit) weg on nömmt dicht dabi op.
i] Der gibt in Worten oder (mehr in diesem Sinne) in der Tat einen guten Besitz, eine einträgliche Stellung u.s.w. leichtfertig auf, um sich bald darauf um eine geringere zu bemühen. Er gießt unreines Wasser eher aus, als er reines hat.
De Schnater steit hum nêt stille.
i] Von einem Schwätzer. Schnater steht für Mund.
De schnelle Entschlüss send de besten.
Ulm
De Scholmeister on de Schmödt die frête allerwegen möt.
Ostpreußen
De Schôlmêster lêke (laichen).
i] So sagt man in Ostpreußen, wenn zur Zeit der Schulferien die Lehrer reisen und zahlreich zusammentreffen.
De Schomakers (Schuhmacher) lopen mit de schofelste Schoh.
i] Weil sie, um Geld zu verdienen, vor allen ihre Kunden bedienen.
De Schrêpe un de Klapesack, de Hâwern mâket de Päre glad.
i] Hier wohl doppelsinnig und zwar für hochdeutsch glatt, und dann mit Bezug auf Klapesack, behandelbar, sanft, geschmeidig.
De Schriftgelehrten sind de ärgsten Weltverkehrten.
Göttingen
De Schriftgelehrten, de Pennlicker, de Blackschiter, se wêt nich, wat 'n Bûren dênt.
De Schuhe sullen wi wohl passen.
Holstein
De Schuhmacher hät Droht.
i] Scherzhafte Antwort auf die Frage: Haltet er gueter Rot?
De Schulde lieged und fuled nid.
Schweiz
De Schulmeister hat ümmer de schlechtesten Blagen (Kinder).
Sauerland
De schwatzt as 'ne Draussel.
De Schwîn dräge sick möt Lager, et ward regne.
i] Wenn die Schweine Stroh im Maule tragen. Wird beziehungsweise auch von Menschen gesagt.
De Schwoanz änzän.
Siebenbürgen/Sachsen
De sehen nicht alle scheel, de over de siden (halve) sên.
De sein Schuld betohlt, vermehrt sein Good.
De serappsche Bûre jage de Pêrd om Januar op de witte Klewer.
Alt-Pillau
De sich bi de Käu (Kuh) vermêdt, de möt se höten.
Mecklenburg
De Sichel schniet de Dong af.
Siegen
De sick äber'n annern sin Unglück freut, de sin eegen steit vör de Döhr un bleut.
De sick anbaut, dessen Laun (Lohn) was nich graut (groß).
Osnabrück
De sick aver'n ander sin Unglück freut, de sin egens steit vör de Dör un bleiht.
Ostfriesland
De sick det Dages haggen, liegen 't Nachts unner den Plaggen.
De sick in Korn un Brannwin besuppt, de is'n Swin.
Ostfriesland
De sick in'n Hofdênst to Dode quält, kumt nich in'n Himmel.
i] Man hat auch kein Beispiel, dass sich jemand in diesem Dienst zu Tode gearbeitet hätte. Hoftage tun, heißt noch jetzt, halb müßig gehen. Damit die Frondienste nicht durch Härte unerträglich wurden, hatte man sie mit schützenden Bestimmungen umgeben. So konnte in der Ernte jeder dem Schneidtage vorstehen, wer eine Egge zur Saat leiten kann; der Schnitter muss nur tapfer genug sein, neun Halme auf dem Rücken zu zählen und mit der Sichel zu durchschneiden, und ein Pflüger fährt so langsam, dass der Fink auf den Radfelgen seine Jungen zu ätzen vermag; gleichwol müssen die Fronder ordentlich beköstigt werden; erst wenn sie satt sind, ist der Dienst fertig. Der Meier gibt schliesslich jedem beim Fortgehen einen Stab in die Hand. Tut er es nicht und der arme Mann fällt sich ein Bein entzwei, so muss er ihn in den Hof zurückführen und auf eigene Kosten arzneien lassen. Manche Dienste waren auch an sich nicht so anstrengender Art, um das Leben zu bedrohen. So mussten in einem Dorfe die Weiber abwechselnd der Gerichtsfrau und ihren Töchtern den Rücken kratzen und alle Morgen die Flöhe aus den Betten suchen.
De sick sülfs de Geck anscheert, kan upholden (aufhalten), wenn he will.
Oldenburg
De sick vör 'n Pannkôken (Pfannkuchen) utgift, wart dervor upfreten.
De sick vör een Hund verhüert, môt Knaken freten.
Ostfriesland
De sick wâr vör Utgift, de wûrd wâr für holden.
De sick wâr vör Utgift, de wûrd wâr für holden.
De sick warför utgifft, de wurd warför holden.
Ostfriesland
De sick warför utgifft, de wurd warför holden.
Ostfriesland
De sick will ehrlich ernähren, môt vêl flicken un wenig vertären.
i] Wer ein geringes Einkommen hat, muss alle Arten des Aufwandes vermeiden, einfache Kost führen und die alten Kleidungsstücke solange als möglich ausbessern
De sik inn Drang mengt, den fret't de Farken (Ferkel).
i] Drang = Getränk für das Vieh.
De sik mit'n Bedler (Bettler) sleit (schlägt), kriggt Lüse.
De sik nich satt ett (isst), de lickt sik ok nich satt.
Oldenburg
De sik sulven loven, de hebben quade nabers.
la] Sese laudanti praesto est vicinia prava.
De sik to mausig makt, de fretet de Katt'n.
De sik vor bedenket, de is klûk, so schit he na nicht in de brûk.
hdt] Klug ist, wer sich zuvor bedacht: hernach der nichts in die Hosen (bruk) macht. Die Bekleidung des Oberschenkels hieß im deutschen Altertume Bruch (bruoch, brôk, braca).
De sik wahrt vör Mârzens Sünn un Aprils Wind, de is un bliv en schön Kind.
Tecklenburg
De sik will êrlig un redlig nêren (nähren), de mut vêl flicken un wenig vertêren.
Holstein
De sik wol beddet, de slöppt got.
De sin (egen) Näs' affsnitt, schännt sin Angesicht.
De sin Dênst (Dienst) anbütt, de sün Lohn is nich grôt.
De sîn Geld nich wêt to verwall'n, de köpe Pötte un lat se fall'n.
Bremen
De sîn Gesundheit bewahrt, bewahrt gên rötterge (faulige) Appel.
i] Von dem hohen Wert der Gesundheit
De sîn Hand tüschen Bôm und Borke steckt, klemmt sick.
Ostfriesland
De sîn Koie (Kühe) vor Ossen anspannt, mag sîn Päre (Pferde) melken.
Oldenburg
De sin Riker (Reicher) wat gift un sin Wiser wat lehrt, de is in de Sottheit verkehrt.
De sîn Rîker wat gift, un sîn Wîser wat lêrt, de is in de Sottheit verkehrt.
i] Riker = dem, der ihm dargereicht, gegeben hat, seinem Geber; Wiser = einem Unterweiser, Lehrmeister; Sottheit = Dummheit.
De sîne Schuld betâlt, vermêrt sin Gôd.
i] Der oldenburger Bauer sieht vor allen Dingen darauf, die Schulden wieder zu bezahlen, die er durch das Abfinden seiner Brüder und das 'Utberaen' (Aussteuern) seiner Schwestern hat machen müßen.
De sitt bi'm Ruder.
i] Er hat hier das Meiste zu sagen.
De sitt noch hübscher ût wie Runzel's Trîn.
i] Katharina Runzel war ein Mädchen in Wehlau, das die Natur an schöner Mitgabe vernachlässigt hatte
De sitt noch hübscher ût wie Runzel's Trîn.
Katharina Runzel war ein Mädchen in Wehlau, das die Natur an schöner Mitgabe vernachlässigt hatte.
De Sjürt es neier üs de Knappe sii.
Sylt
De släprig is, de slümm'rig is, wat deit he bi de Brût.
hdt Wer schläfrig ist, was soll der bei der Braut.
De slimme Schaden.
i] Schlag- oder Fallsucht.
De smutzige Wäsche un de Lögen sammelt sek.
i] Wie der schmutzigen Wäsche immer mehr wird, so werden auch der Lügen, ist erst angefangen, immer mehr.
De snakt as en Mettwurst, di an beiden Ennen âpen is.
Ostfriesland
De Snater steît em nich ên Ogenblick.
De Snîder (Schneider) het mit de hête Natel neit.
Holstein
De Snîder seggt: Dar hangt 'n Stück Speck. De Schohmaker seggt: 'K will der nix van hebben. De Wefer seggt: Do mi't man her! Der Zimmermann seggt: Dar hest't.
De Snîders hebben man ên Darm, man de ên Darm is lank.
i] Den ersten Teil behauptet man ironisch von den Schneidern, um zu sagen, dass sie wenig Nahrung bedürfen, worauf sie aber mit dem andern Teil antworten.
De söcht fief Föt (Füße) up een Schâp.
i] Er sucht im Handel und Verkehr seinen Schnitt so zu machen, dass er Vorteil hat
De Sog vergett (to licht), dat se ok ees Farken wäst ist.
De Sogkinder un de Mesteswîn mötet den meisten Dost lîen.
hdt] Saugkinder (Säuglinge) und Mastschweine müßen den meisten Durst leiden.
De Sommers fischen geit un Winters Finken sleiht, dor 't nich god in de Kok tosteiht.
Süderdithmarschen
De Sonne föllt in'n Sump, morgen regent', dat't so plumpt.
De Sonne geiht under den Huddick, morgen regent 't uns in de Fuddick.
i] Huddick = Hutte = finstere Miene, Hutzler = schwarze Gewitterwolke; Fuddick = Tasche
De Sonne geit in'n Swalk et giewt morgen Reagen.
Westfalen
De söppt wie de wasseninker Mäkes.
i] Wasseninken ist ein Dorf im Kirchspiel Budweten, Kreis Ragnit. Vor noch nicht langer Zeit war dort starkes Trinken sehr zu Hause. Es trank Alt und Jung, besonders aber sollen sich nach der obigen Redensart die Mädchen darin ausgezeichnet haben.
De Span gehört den Zimmermann.
Rendsburg
De Spandêrbüxe anhebb'n.
De spart vör'n Mund, spart vör Katt un Hunt.
Ostfriesland
De Speck wird do nid tüf.
i] Zu Wohlstand kann man es dort nicht bringen.
De Spinn de spönnt, de lewe Gottke sönnt, wenn et doach nicht lang dure.
i] Bezieht sich auf den 'fliegenden Sommer' im schönen Herbst.
De Spott is den Düvel sin Angel.
De Sprît is em in Kopp stîgen.
Holstein
De Stadtbull tauirst, as to Teterow.
z] Up dat olle Dur in Teterow wuss immer 'n beten schön Gras, de Börger argern sik, dat dat so ümkommen möt, un dörch Rat un Börgerschaft ward beslaten, dat jedes Jahr ein Börger dat Gras dörch sin Kauh afweiden laten dörft. Da keiner den annern dat gönnt, so sall tauirst de Stadtbull rup. Sie winden den Bullen also in de Höcht. Als hei ball baben is, steckt hei de Tung wit ut, un de Teterowschen schrien: Süh, wie hei all leckmündt.
De Stecken vör'n Kalwerstall is weg.
i] Wenn jemand in seiner Ausgelassenheit alle Grenzen überschreitet.
De steht zwesche Hangen un Würgen.
Bedburg
De steiht sik breet.
De steit för de Feend (Feind) as 'n isern Bull.
Ostfriesland
De steit up as Hinnerk Paus.
Ostfriesland
De steit up as Hinnerk Paus.
Ostfriesland
De Stendalischen trinket gern Wyn, de Gardelever dat wilt Junkers syn, de Tangermündschen hebbet den Moth, de Soltwedelschen hebbet dat Goth, de Seehüser det sint Ebentür (Abenteurer), de Osterborger wolden sick reken un deden den Bullen vör 'n Baren dod steken.
i] Die sieben Städte sind schon durch lateinische Distichen besungen worden.
De Stêrt (Schwanz) hoch hol'n.
De Stickelten (Stachelbeeren) sind noch nich riype.
Büren
De Sticken vör dem Kälwerstall is weg.
i] Um ausgelassene Lustigkeit, die den Charakter der Albernheit hat, zu bezeichnen.
De Stier hebt me bin Hörnere, de Ma bin Worte und s Wiib bi der Jüppe.
Schwiizertütsch
De Stier helt me bin Hörnern, de Mann bin Wort und 's Weib bi der Jüppe.
De stillesten Wâtere brêket de dêpesten Löchere.
De stillsten Waters hebbt de dêpsten Grünne.
z] De stillsten Water hebben de dêpsten Gründe. Leute, die nicht viel Worte machen, sind oft die gefährlichsten.
De Störk is sîn Fêren ewen sô gôd nödig as de Lüning.
Ostfriesland
De Streue schüttle.
i] Ein böses Spiel machen, nachtheiliges Urteil gegen andere bereiten.
De Stuel öberchera.
i] Die Bühne, worauf der Stuhl des regierenden Landammann steht, umstürzen, Zeichen der Revolution.
De Stunne vor der Sunnen tüt dor de Plunnen, segt de Fos.
i] Kurz vor Sonnenuntergang ist es am kältesten. Eine Stunde vor der Sonne zieht die Kälte durch die Lumpen (Kleider).