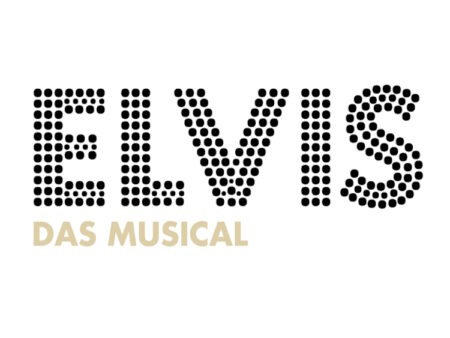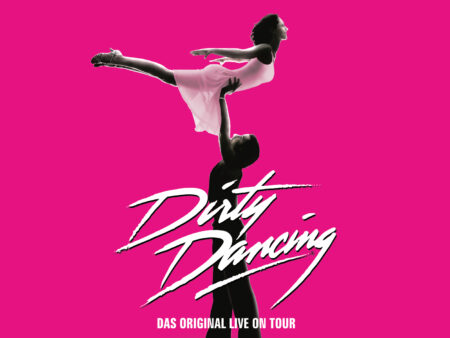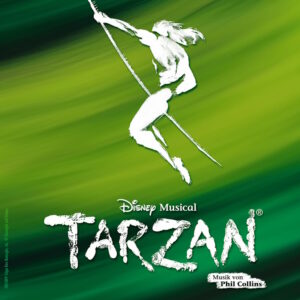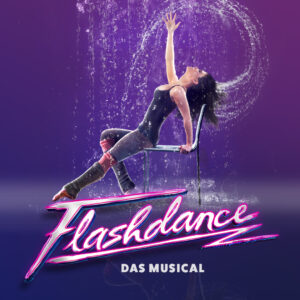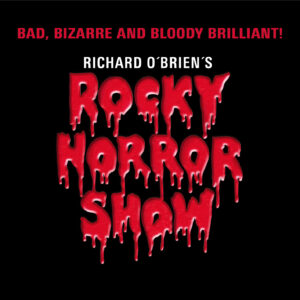De Jungfer er Brot steit up't Fenster.
De Jungfer is Brût, êr Für (ihr Feuer) geit ût, êr Elend geit an.
Ostfriesland
De Jungfern kriegt so lichte enen placken, as ene witte schorte.
De Kâ (Kuh) lîft är Kâlf.
Siebenb.-sächsisch
De kacken alle op einen Häup.
Sauerland
De kacken will, mutt de Eers dartodon.
hdt] Wer kacken will, muss den Arsch mitbringen.
De kackt di vör de Dor un bringt di kên Bessem (Besen) mit.
Ostfriesland
De Kalender schröfft on de lewe Gott göfft.
De Käm (Kümmel) is manni (mancher) en sin Verdarf.
Rendsburg
De kam wi mit Jan Blaufink her.
i] Rufen die Gassenjungen in Holsteinischen Städten, wenn sie mit einem betrunkenen Menschen in ihren Karren Gespött treiben. Fink heißt ein lustiger Geselle, und Blaufink nennt man in Holstein den Jungen, der als Anführer oder Narr der Horde gewöhnlich mit einer Papiermütze und bemaltem Gesicht mit seinen Grimassen durch die Straßen der Städte zieht.
De Kamm swellt hum.
Ostfriesen
De kann dem Priester de Schrift ûtleggen.
Pommern
De kann dör 'n eken (eichenes) Brett kîken.
Rastede
De kann mehr lêge (lügen) als nöge Pêrd renne können.
De kann mehr lêge, als tin Joch Oße pflêge.
Samland
De kann mêr as Brot êten.
i] Der Abergläubige von einer alten Frau, die er im Verdacht von Zaubermitteln hat
De kann met de Schaf ut êne Rêp (Raufe) frête.
Litauen
De kann nich schriewe on nich lese, on öss doch Borgemeister.
jüdisch-deutsch] Nit schreiben, nit leijenen, ün doch a Borjemaster. Warschau
De kann nich verderben, all sitt he ock bet an de beide Ohren in 't Salt.
i] All = ôk, so viel als: aber, auch, obschon, obgleich.
De kann nu up den Dûm (Daumen) floiten.
Rastede
De kann ook ut Dreck Quark maken.
De kann Schafkötel vör Rosin'n verköp'n.
Pommern
De kann sîn Arschloch möt em Pfennig bedecken.
Korkehmen
De kann sîn Ârschloch möt em Pfennig bedecken.
Korkehmen
De kann singen un flötet datô.
Pommern
De kann swîgen, de hêt êten kann.
Holstein
De kann up den Propp (Pfropfen) rüken.
Rastede
De Karoliner Klockendefe.
i] Die Carolinensieler sollen einmal aus dem Esenser Turm eine Glocke gestohlen und dieselbe, weil ihnen die Esenser auf der Spur waren, nahe bei Carolinensiel in einen Kolk, Waal genannt, versenkt haben, wo sie noch zuweilen unter dem Wasser gehört wird, eine Sage, die sich auch an anderen Orten findet.
De Kau (Kuh) melkt dorch de Stroote, un et Haun leit dorch'n Kropp.
i] Ohne gut Futter weder Milch noch Eier.
De Kau (Kuh) mot dôr den Hals emulken wern.
i] emulken = das plattdeutsche 'melken' bezeichnet melken und milchen.
De Kaüe (Kuh), dä den Kalwern am mesten noa bölket, vergiätet se am ersten.
Iserlohn
De Kauh vergett, dat sei ok ees 'n Kalf wäst is.
De kê'n Dreelink (Dreier) acht, wart kênen Dâlers Harr.
Mecklenburg-Schwerin.
De Kerbess (Kürbis) blän des Owest.
De Kettel (Kitzel) steckt em darna.
De Kierl rüükt noch nå 't Kinnerdauk.
De Kinnenk (Könige) dinken, se tîrften den Angtertônen nor de Ûge lossen, dat se dermät schrâ känden.
De Kinner (Kinder), de se mitnander telet, will ik ok wohl mit'n Ellbogen grot sögen.
De Kirmes is innse an die Menscher (seins) au.
Agnetendorf im Kreise Hirschberg
De Klänn (Kleinen) missa de Pauka trän (tragen), on wenns om heilja Tache es.
De klauken (kluffen) Hoiner (Hühner) legget ok in de Neteln un verbrennt sek den Nors.
Göttingen
De klein' Dew (Diebe) hangt 'n, de grôt'n lött 'n lop'n.
Altmark
De klin Dräckeltcher schtäinjken ärger wä de grîssen.
De klinn Dîbe (Diebe) hengt ma, de grûssen lest ma lôfen.
Breslau
De Klock geit, as de Köster de Kopp steit.
Ostfriesland
De Klock lüd ik sülwen, säd' de Bûr, dôr störr he den Köster von sîn Fru.
De Klock mag gahn as se will, 'n wîse Mann wêt sîn Tîd.
i] Ein ordentlicher Mann weiß, wenn es Zeit ist, aus dem Wirtshause heimzugehen
De Klocke is koppern, wenn man wat itt, so is 't Mahltid.
De Klökste gifft na, sä de Buer to sein Ossen, Osse, giv nu na!
De Klökste gifft na, sä de Buur, dor neih he vör'n Bullen ut.
De Knê steit frê.
Ostfriesland
De Knödl sein 'gessen, jetzt waar was zum Essen recht.
De Knüppel liggt jümmer bi'n Hund.
De Kô (Kuh) fret mit fîf (fünf) Münde.
Ostfriesland
De Koe (Kuh) mit'n Kalve krig'n.
De Koh (Kuh) gifft'n Emmer vull Melk, un schmitt hum weer um.
De Koh (Kuh) kost't nich mehr, weil se bunt is.
De Koh (Kuh) sett de Tafel to.
i] Rühmt den großen Nutzen der Kuh.
De Koh (Kuh) vergitt, dat se ên Kalv west is.
Holstein
De Koh (Kuh) will dörch denn Hals melkt sin.
Rendsburg
De Koh (Kuh), de e schmêrge Zogel heft, schleit öm söck on makt ok andre schmêrig.
De Koh is slanker as de Katt.
i] Keine Empfehlung der Kuh', da sie dann sehr mager sein muss.
De Koh schall nich vergeten, dat se ok mal Kalf wesen is!
De Koh vergittet jümmer dat se en Kalf gewesst is.
De koherde (Kuhhede) unde de swîne blaset sik selfvest ût dem Dorp.
Lübben
De Kommerschaft schad (scheidet, trennt) de Freindschafd.
Trier
De könnt Awens (Ofen) utschmere.
i] Der Bettler.
De Kôpmann (Kaufmann) seggt: Was wollen Sie haben (sich holen)? Der Prêster seggt: Was bringen Sie'?
Pommern
De Kopp (Kopf) is dog nig dran fast.
i] Die Sache ist doch so wichtig und der Fehler so groß nicht.
De Kôr laowt sîn Käl un wenn se ôk näg'n Krümm hät.
Altmark
De Körbôm söcht (sucht), de Fûlbôm find't.
Oldenburg
De Kôrnmoder kömmt.
Ostpreuss. Oberland
De Köster (Küster) es de Selfkant von de Geislechkeit.
Meurs
De Köster (Küster) un de Hund verdeent ehr Geld mit'n Mund.
De Kranke sitt up 't Bed(de), de Fêge sitt dervör.
Ostfriesland
De Krätta verhaua; 's Blech gwärma.
Oepfingen
De Kraug geit sau lange tau Wâter, bet he brekt.
De Kraus (Krug) gett sau lange te Wâter, bitt'e bricket.
De krêgnen eischen Willkâm (Willkommen).
i] Sagt man, wenn ein Ankommender mit Scheltworten oder Schlägen empfangen wird.
De Krepp löf dem Pärd noch.
Bedburg
De Kribbken inn Kopp krig'n.
i] Grillen.
De Krieg lîdt kei Pröbli.
Schweiz
De Krô (Krähe) mâcht det Käst aus Därm.
De Kroe (Krähe) krîsche nô Schnî.
Siebenbürgen/Sachsen
De kröggt de Schlang det Ei weg, dat se nich e mal zischt.
De Kruke gêt so lang to Water, bet se breke.
Pommern
De Krût (Kraut) un Bickbeern plücken will, de bruk sin Holtschen un sin Brill; dar ligt in mannich düsterm Lake verdeckt en Töcke oder Saake.
De Kübel umstoße (umschütten).
Schaffhausen
De Kuckuck röpt sinen eigenen Namen.
Hannover
De Kuckuck und de Achternagel, dat sünt de rechten Sommervagel.
De Kuhrer töme dp Pêrd' af on gahne op Parêske.
i] Gross-Kuhren ist ein Dorf in Samland, Kreis Fischhausen.
De kümmt nog in de Smullerij üm.
i] In ihrem Hause wie an ihrer Person ist alles schmutzig und unrein. Smullerij = Sudelei, schmutzige Haushaltung.
De kumt van de Matt up dat Stro.
z] Kumpst von der matten auf das strö.
De Kunst stiggt immer höger, uns' Köster word 'n Kröger (Schenkwirt).
i] Von schlecht besoldeten Lehrern entlehnt, die, um ihren Lebensunterhalt zu erwerben, einen andern Beruf wählen oder aber als Nebenberuf betreiben.
De Kunst stigt ümmer höger, ut en Paster ward en Kröger; die Kunst ward ümmer 'ringer, ut en Doktor ward en Schinner.
Hausinschrift in Schönberg
De Kunst wert balt betteln gîn.
Schlesien
De Kusen fangt mi an to prummeln.
De Kûtse (Kutsche) barst (berstet, bricht), de Emders kamen mit negen Mann.
i] Schildert die Sparsamkeit der Emder, welche die Gewohnheit haben, in einer größeren Anzahl zusammen eine Mietkutsche zu nehmen, die oft bis zum Bersten gefüllt sein soll.
De l'abondance du coeur la bouche parle.
de] Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.
De l'abondance du coeur la bouche parle.
Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über.