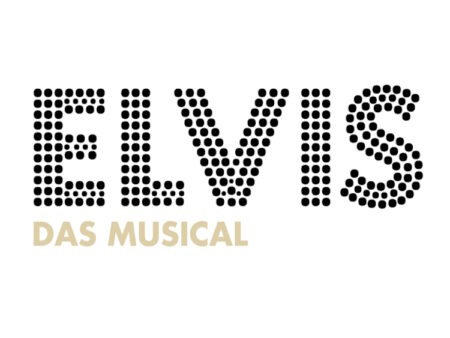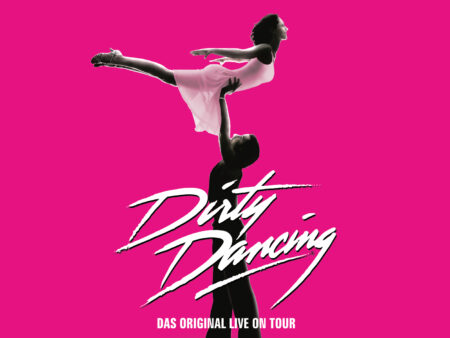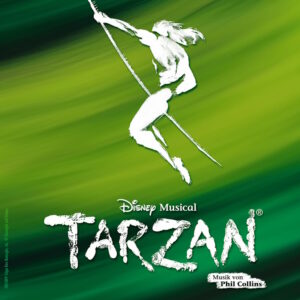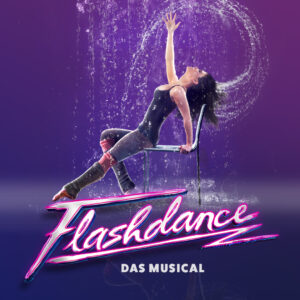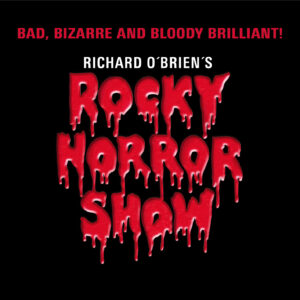De hilligen drei Küenige (Könige) (6. Jan.) bugget 'ne Brügge odder te breaket eine.
Büren
De Himmel fangt en bitjen an to swêten.
Holstein
De Hîn (Henne) lîft är Achen.
Siebenbürgisch-sächsisch
De Hitte bringet de Witte (Weiße) auf der Bleiche.
Hannover
De Hitte geit met den Rake up.
Göttingen
De hoc satis.
Cicero
De Hök noh et Weêr hange.
Aachen
De Holder kummt de erste Drunk to.
De Hollander kommt met de Slaapmuts (Schlafmütze) op de Wereld.
i] Im Widerspruch mit dem größten Arzte Hollands, der die Füße warm und den Kopf kalt verlangte, hat der Holländer überall, selbst am warmen Ofen, seinen Kopf bedeckt. Man sieht nicht allein die Kinder, selbst im Bette, mit doppelten Mützen auf dem Kopfe, sogar im Sommer; sondern selbst die Jungen und Männer tragen dicke baumwollene Schlafmützen. Das obige Sprichwort dient als Entschuldigung.
De Holler kumt de êrste Drunk to.
Ostfriesland
De Hônder (Hühner), de am miezte kâkeln, läge nit immer de bässte Eier.
Köln
De Höner (Hühner) so im Korbe syn, weren gerne heruth; de öuerst dar buten syn, weren gerne herin.
De Hönere (Hühner) lêget de Eggere (Eier) un de Mâkens (Mädchen) säuket (suchen) de Frigger (Freier).
Waldeck
De Hôrkindere (Hurenkinder) hebbet det meiste Glück.
ndt] Horkinner hevt et beste Glicke. Harz
De Hühner fliegt mit'm Strohhalm, et giet gued Wear.
Büren
De Hûk is mi dâl schoten.
i] Das Zäpfchen im Halse ist mir angeschwollen und dadurch verlängert
De hülfen Klocken (Dreschflegel) goaht.
Büren
De Hun(de) un de Adellü(de) mâkt kên Dör (Tür) achter sick tô.
Ostfriesland
De Hund abloh.
Luzern
De Hund blifft alltîd vör de Stêrt.
Ostfriesland
De Hund is an den Knüppel gebungen.
Waldeck
De Hund mache.
Luzern
De Hund sall dî 'n Kloppkôken schîten.
Pommern
De Hund', de am fründlichst'n swänzeln, de bît'n teerst.
i] Dem Schmeichler ist am wenigsten zu trauen
De Hund, de blafft, bitt (beisst) nich.
De Hund, de bött (biß),
De Hund, de een'n bäten hät, doavan mütt'n an Hoar upbinden.
De Hund, de sick Dâgs gnabben, krabben sick Nachts.
De Hund, dei bellt, dei bit nich.
De Hunde honnem wul a Wäk gefrassen, doss a nich hâr kimmt.
hdt] Die Hunde haben ihm wohl den Weg gefressen, dass er nicht herkommt.
De Hunde un de Aedellü mâkt gên Döhr achter sik to.
Ostfriesland
De Hunger drifft (treibt) et herin, söd de Soldat, as he Speck up 't Botterbrot leggde.
Ostfriesland
De Hunger drifft et rin! sä de Zuldate, as he Speck up't Bodder brod leggde.
De Hungerdôk is follen.
i] Das in den Kirchchören ausgehangene Tuch zum Zeichen der angegangenen päpstlichen Fasten ist eingezogen, die Fasten sind beendigt.
De Hunn gât nîren up Plan- (oder Vlân-) schauen.
hdt] Die Hunde gehen nirgends auf Planschuhen.
De Huve begheten.
hdt] Die Haube begießen.
De iersten vier Wochen möt de jung' Frau keen Båbenköst (= obere Brotkruste) hebben, süß ward se to klok.
De Iesel (Esel) heat 'n ut der Wand slagen.
Westfalen
De Iesel (Esel) is all (bereits) heriut.
Westfalen
De iirst (erste) Gewinner - de läst Verspäler (Verlierer).
Strelitz
De Immenschwarm im Mê is wert en gonz Föhr (Fuder) Höh (Heu).
De immer to Marcht (Markt) geit un flitig Vadder (Taufpate) steit, den wä(r)t dat Geld nich olt in d' Tasch.
Altmark
De in 't Reit (Reis) sitt, het gôd Pîpen (Pfeifen) snîden.
Ostfriesland
De in de en Hand fleut un in de anner wünscht, hett in beid lik väl.
Strelitz
De in de Lotterie sett't, ward selten oder nie fett.
De in'r Jögd (Jugend) fahrt, mutt up't Older gan.
De in't Reit sitt, hett god Piepen snieen.
De Inkôp (Enkuaf) deit Verkôp.
Ostfriesland
De Ire woßen am.
Siebenbürgen/Sachsen
De Iren wôssen em, wää dem Jisel da eme luewt (da man ihn lobt).
De irscht Hangd (Hund) miss em än't Wasser schméisse, sonst wärde se rôsendig.
Siebenbürgisch-sächsisch
De irscht Hangd (Hund) schméisst em än de Bâch.
Siebenbürgisch-sächsisch
De îrst Nôd möt kîhrt wârd'n, säd' de oll Frû (o. jenes Mädle), dorn haugt se 'n Backeltrog intwei un mâkt Süerwâter het.
Mecklenburg
De is bang', dat't verschimmelt.
De is bi sik.
De is dem Düwel (Teufel), as he slêp, ut de Höll lopen.
i] Von einem schlechten Menschen.
De is denn Düvel von'r Schufkarn fullen.
De is di to modig (mutig).
i] Mit der Person wirst du nicht auskommen.
De is een Glattschnader.
Rendsburg
De is got bi Schick.
De is got in de Wehr. (o. in'n Wams).
De is hier so vêl nütt as dat fövte Rad am Wagen.
Pommern
De is in unsern Wasser nich getauft.
i] Das ist ein Fremder.
De is Liegens dull.
i] Man kann ihn nicht zum Aufstehen bewegen.
De is man mit Minschenhût äwertagen.
i] Er ist so böse, dass er nur aussieht wie ein Mensch, nur eine menschliche Haut als Überzug besitzt.
De is met 'n Oars in 't Botterfass fallen, de sitt wêk.
De is met 'n Oars in 't Botterfass fallen, de sitt wêk.
De is mit den Ulks beseten.
i] Man denkt sich dabei einen Plagegeist, einen Urheber von Übel, Unglück, Verlust.
De is mit Ehren ünner de Hüll kamen.
Ostfriesland
De is mit Krabbenwater döft.
i] In Wismar gebräuchlich, um anzudeuten, dass jemand alle Eigentümlichkeiten der Wismarschen Verhältnisse kenne und an sich habe. - Die Krabbe (Palaeman squilla L.) wird in dem Wismarschen Busen in großer Menge gefangen und ist als beliebte Delikatesse weithin bekannt. An der ganzen Mecklenburger Küste ist der Wismarsche Busen der ergiebigste Ort für den Krabbenfang.
De is nett so moj as'n Bûren(Jöden-)brût.
i] Wer sich sehr bunt, aber geschmacklos aufgeputzt hat.
De is nett so mooi as 'n Jödenbrûd.
Ostfriesland
De is ôk so drîst (dreist) as jenn Jung, de slôg sînen Herrn 'n Knipschen voer de Naes', he hadde (hâr) öwer de Hand inne Tasch.
Mecklenburg
De is ror to Wech.
De is sien Geld gråm.
De is sîn Liewe wual nich achter Môrs (Mutters) Potte ekoumen.
De is sîn Mann ankamen.
i] Er hat seinen Mann, d.i. Gegner gefunden. Auch: Er ist sehr unangenehm überrascht worden.
De is so nietwätern (neugierig) as ne Zêge.
De is uns Herrgott sin Nix.
Holstein
De is verloren as 'n Jüdenseel.
De is wert, dat he mit heeter Myge (Harn) begotten were.
Holstein
De is woll erhåben, ower noch nicht begråben.
De Iulen (Eulen) un Kräggen waren (hüten).
Westfalen
De Jägerlumpen, de Blîklumpen und langnäste Hund'n hett de Düvel erfund'n, harr de Voss seggt.
De Jangen am Schwiss, de Alen de Hainjd äm Schîss.
i] Die Jungen sollen schwitzen, die Alten können die Hände in den Schoß legen und ruhen.
De jen Krêk hacket de üdder niin Ag üt. Sylt
De Jever heft, as de Haasens siewen Hüe (Häute), man he leggt 'r alle Dâge êne van af.
Osnabrück
De Jud deit den Christ kê Gut.
Rendsburg
De Jugend is wild, hadde de Beadelfrû (Pottwif) sagt, do was ear dat Kind (Blage) ut der Kipe fallen.
Westfalen
De Jugend mot êst (erst) de Narrenscho uttreaen.
Büren
De Jung is de Moder êr Nadelkissen.
i] Er hengt sich an die Mutter an, wie ihr Nadelkissen, das holsteinische Frauen neben dem Schüsselbunde an der Seite zu tragen pflegen.
De Jung is nett (just) so poll (rund und fleischig) as 'n räs'n Klütje.
De Jung is so schitterg as 'n nöchtern Kalf.
De Jung is verdwalen (verirrt) as 'n Leferke (Lerche) up de Haide.
De Jung is wranterg (verdriesslich), wi kriegen Unwêer.
De Junge is'n rechte Ritensplit.
De Junge wärt grot, wör Vâr un Môr man dot.
Grafschaft Mark
De Junge wet sick in heiler Hût (Haut) nich to bergen.
Lippe
De Jungen könt de Olden wall verlaten, man nicht entrathen.
Lathen in Hannover
De Jungens kann me verhuirathen, wenn me will; over de Dörens mot me verhuirathen, wenn me kann.
Sauerland